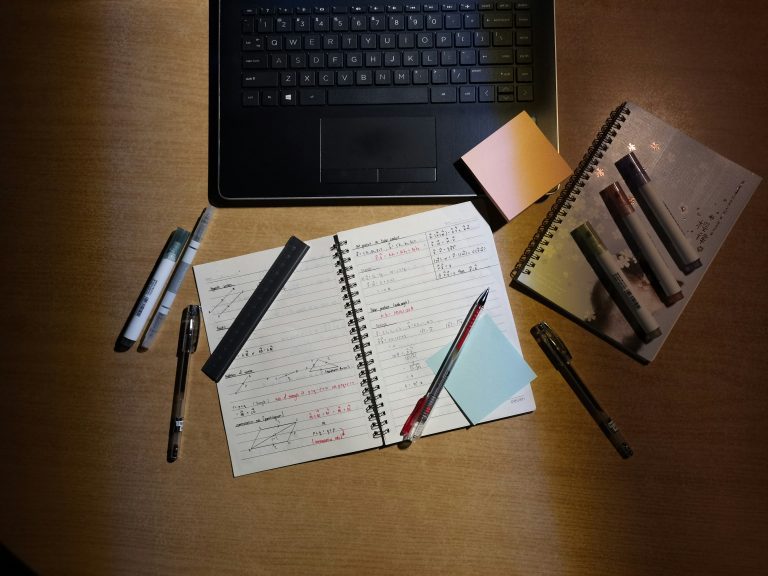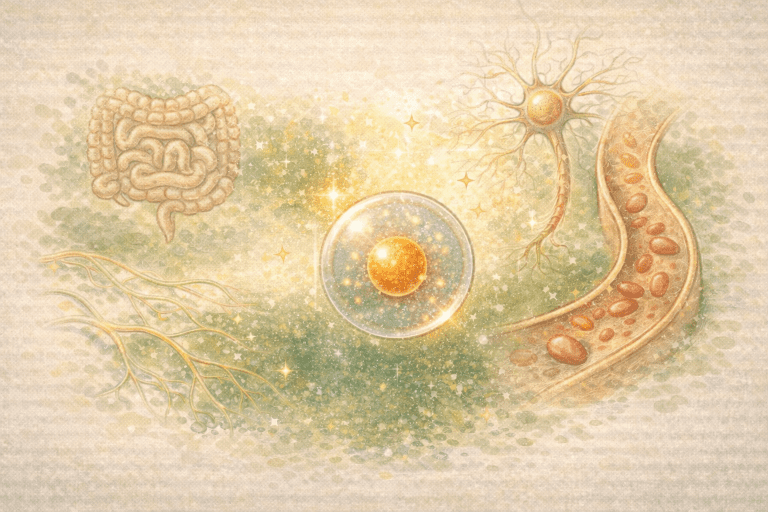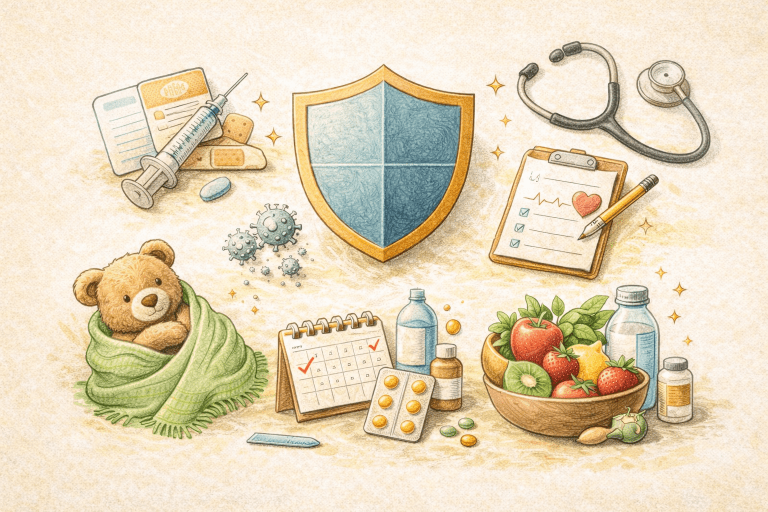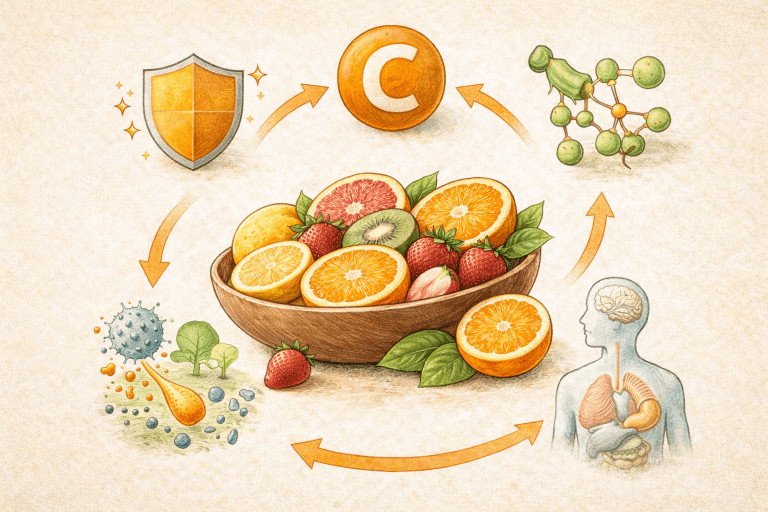Als ich nach spannenden psychologischen Themen gesucht habe, bin ich auf den Zeigarnik-Effekt gestoßen. Schon beim ersten Lesen viel mir auf, dass ich den Effekt kenne: Aufgaben, die ich unterbrechen musste, halten sich hartnäckig im Kopf bis sie abgeschlossen sind. Gerade in meinem Alltag als Softwareentwickler begegnet mir das ständig. Ich arbeite daran einen Bug zu beheben oder ein neues Feature einzubauen und werde durch Regeltermine oder unerwartete Anrufe unterbrochen. Es ist dann schwierig den Kontext zu wechseln, weil die unbeendete Aufgabe immer noch im Hinterkopf schwirrt. Das ist ein negativer Aspekt, der durch den Zeigarnik-Effekt ausgelöst wird. Die weitere Rechere hat gezeigt, dass es auch positive Aspekte gibt. Ich nehme dich mit bei einer Recherche, die beim Zeigarnik-Effekt gestartet hat.
Beginn der Recherche: Der Zeigarnik-Effekt
Im Wikipedia-Beitrag zum Zeigarnik-Effekt ist die originale Quelle verlinkt. Das ist die Dissertation von Bluma Zeigarnik die unter Kurt Lewin promoviert hat. Bluma Zeigarnik hat in Ihrer Dissertation verschiedene Experimente mit 164 Teilnehmern durchgeführt. Den Probanden wurden mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert. Je nach Versuchsdesign durften die Probanden die Aufgabe entweder vollständig ausführen oder sie wurden unterbrochen. Die Probanden sollten sich dann später an die Aufgaben zu erinnern. Die Erinnerung der Probanden wurde entweder durch direkte Abfrage z.B. das Aufzählen der Aufgaben oder durch das Nachvollziehen von Handlungsabläufen der jeweiligen Aufgabe getestet. Es wurden dann Messungen zur Dauer, Genauigkeit, Pausen und Unsicherheiten beim Reproduzieren durchgeführt. Die Experimente lieferten klare Erkenntnisse darüber, wie sich Unterbrechungen auf das Erinnerungsvermögen auswirken – und zeigten einen deutlichen Unterschied zwischen unterbrochenen und abgeschlossenen Aufgaben. Unerledigte Aufgaben wurden im Durchschnitt nahezu doppelt so gut behalten wie erledigte. Und was ist jetzt das gute an Unterbrechungen von Aufgaben?
Unterbrechungen können die Kreativität steigern
Laut einer wissenschaftlichen Ausarbeitung (The Recovery Effect: The Creative Potential of Frequent Interruptions) können Unterbrechungen von divergenten Aufgaben (kreative open-end Aufgaben, wo es darum geht möglichst viele unterschiedliche originelle Lösungen oder Ideen zu generieren), sowohl zu einer erhöhten Anzahl an generierten Ideen sowie zu einer höheren Flexibilität und Originalität führen. Außerdem gibt es den Recovery-Effekt der beschreibt, dass in Zeitabschnitten nach Unterbrechungen ein signifikanter Anstieg der Ideenproduktion zu beobachten ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die Aufgaben, die man tätigt, ständig unterbrechen sollte, denn in der Ausarbeitung wird auch gesagt, dass zu viele Unterbrechungen zu Ablenkung, Frustration oder Erschöpfung führen können.
Ein weiterer interessanter Effekt ist der Inkubationseffekt. Der Inkubationseffekt zeigt, dass unser Gehirn selbst dann weiterarbeitet, wenn wir eine Aufgabe kurz beiseitelegen. Eine meta-analytische Übersicht (Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review) belegt, dass Problemlösungen oft im Hintergrund reifen, während wir scheinbar etwas anderes tun.
Nach diesem Erkenntnissen könnte man denken, man müsse schwierige Aufgaben einfach nur Unterbrechen und dann käme die Lösung von alleine. Aber Unterbrechungen sind nicht immer förderlich.
Don’t Stop the Flow!
Eine spannende Studie von Weber et al. (2018) (Effects of Flow Disruptions on Mental Workload and Surgical Performance in Robotic-Assisted Surgery) zeigt, dass Unterbrechungen während komplexer Aufgaben wie chirurgischen Eingriffen nicht nur Zeit kosten – sie erhöhen auch die mentale Belastung und beeinträchtigen die Teamarbeit. Im Schnitt traten etwa 16 Flow-Störungen pro Stunde auf, verursacht durch Kollegen, Ausrüstungsprobleme oder Bewegungen im Operationssaal.
Für Softwareentwickler, Kreative oder alle, die hochkonzentriert arbeiten müssen, hat das eine klare Botschaft: Jede Unterbrechung kann den „Flow“ zerstören, die Effizienz senken und die mentale Energie auffressen. Die Studie verdeutlicht, dass man Unterbrechungen bewusst minimieren sollte, um konzentriert und produktiv zu bleiben – auch außerhalb des OP-Saals.
Fazit: Unterbrechungen bewusst nutzen
Unterbrechungen sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits halten unerledigte Aufgaben unser Gehirn aktiv (Zeigarnik-Effekt), fördern kreative Ideen (Recovery-Effekt) und lassen Lösungen im Hintergrund reifen (Inkubationseffekt). Andererseits können sie den Flow zerstören, die Konzentration mindern und Stress erhöhen – wie die Studie von Weber et al. eindrucksvoll zeigt.
Der Schlüssel liegt darin, Unterbrechungen bewusst zu gestalten: Plane kurze Pausen, nutze To-Do-Listen, um Aufgaben zu „parken“, und schaffe ungestörte Zeitfenster für konzentrierte Arbeit. So kannst du die Vorteile der Unterbrechungen für Kreativität und Problemlösung nutzen, ohne dabei deine Produktivität zu opfern.